“Für den Einsamen ist schon Lärm ein Trost.”
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)
The dark side of everything
Um die Geschichte zum „Crow Song“ zu erzählen, müssen wir weit zurückreisen… in eine Zeit, in der Botany Bay noch sehr anders aussah. Eine Zeit, in der ich allein kämpfte, in der es wirklich und tatsächlich ein Kampf war, und in der es immer und immer wieder danach aussah, als würde ich ihn verlieren.

Alles beginnt mit der vermutlich nicht besonders überraschenden Einsicht, dass es ein Leben vor „Grounded“ gab… und eine Band vor Botany Bay. Dieses Leben führte ich lange Zeit glücklich und zufrieden in Karlsruhe, die Band hiess Ubik Paint, und das alles ist nun wirklich schon sehr lange her.
Irgendwann, als es mit Ubik Paint zu Ende ging, traf ich in diesem Leben vor „Grounded“ die falschen Entscheidungen. Welche, das muss jetzt gar nicht unbedingt näher beleuchtet werden. Vieles davon hatte mit Beziehungen zu tun, mit Freundschaften, und damit, wie ich mein weiteres Leben gestalten wollte… und es führte in seiner Gesamtheit dazu, dass es mir sehr bald sehr beschissen ging, ganz fürchterlich beschissen sogar.
Das muss so um das Jahr 2000 herum gewesen sein.
Was die wenigsten wissen: Halb weil ich ohne Musik nicht leben kann und halb aus therapeutischen Gründen nahm ich damals unter dem Namen „The Turtle Dreams“ ein Soloalbum auf. Die Aufnahmen waren die letzten, die in meinem alten Zuhause in Karlsruhe statt fanden, und ich brachte sie tatsächlich zu Ende; grösstenteils ich allein, mit zeitweise aufopfernder Hilfe meiner alten Ubik-Paint-Kollegen. Zum Schluss hatte ich ein fertiges Album, zu dem es sogar eine Single gab, die ich umsonst im WWW verschenkte… und eine kleine Premieren-Feier in der Werkstatt, in der ich es aufgenommen hatte.
Meine Musik umsonst im WWW zu verschenken, das klappte damals glücklicherweise schon ganz genau so exzellent wie heute auch, und deshalb wird sich niemals jemand an „The Traveller Song“ erinnern. Und die wenigen Leute die der Premiere beiwohnten und alle 12 Stücke anhören mussten, die haben sie hoffentlich inzwischen auch verdrängt. Auf jeden Fall wurde eines sehr schnell klar: Dieses Album konnte man niemandem antun, so vernichtend depressiv, lebensverneinend, düster und zerbrechlich war es geworden, und so verheerend war seine Wirkung auf diejenigen wenigen Menschen gewesen, die es gehört hatten.
Ich zog von Karlsruhe nach Heidelberg und verstummte in den folgenden drei Jahren vollständig, was die Musik betraf. Die Anstrengung, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, brachte das leider mit sich. Im Frühjahr 2004 war es endlich so weit, dass ich mich wieder an ein Musikinstrument herantraute, und langsam aber sicher begann ich, mich aus den Trümmern zu erheben. Eine Sache die mir dabei vollständig klar war: Ich wollte auf keinen Fall wieder Lieder über mich selbst schreiben. Auf keinen Fall selbstreflektiv sein und somit Gefahr laufen, wieder auch nur in die ungefähre Nähe meines letzten Projektes zu kommen.
Also begann ich mit ein paar Instrumentals, und schliesslich kamen die ersten Songs dazu, in denen ich mich nicht mit mir und meinen Gefühlen beschäftigte, sondern mit Dingen, die ich um mich herum beobachtete. Es waren dies drei Lieder mit den Titeln „Apologize“, „Canvas“ und „Little Princess“ (der Kenner wird an dieser Stelle bemerken: Eines davon schaffte es auf „Grounded“). Besonders ergiebig war das nicht, aber ich wusste damals nicht, wie ich meine kreative Energie besser hätte kanalisieren können…
Die Hölle von Heidelberg
Als ich in Heidelberg endlich wieder damit begonnen hatte, Musik zu machen, da stieß dies in meinem unmittelbaren Umfeld hauptsächlich auf Unverständnis. Schließlich war ich mit meinem Studium sehr spät dran und hätte da mal was tun müssen, hatte konstant Geldsorgen, wohnte in WGs und war eh so ein komischer Typ. Das mit den WGs war erstmal das Hauptproblem… so gut wie keiner meiner Mitbewohner goutierte die Geräuschentwicklung, mit der Musik verbunden ist, und selbst wenn ich nur elektronische Instrumente spielte und den Kopfhörer auf hatte, so gab es liebreizende Gestalten die sich auch am leisesten Klappern der Tasten störten.

Doch nicht alles war Scheiße: Über die Jahre lernte ich in Heidelberg auch Musiker und potentielle Mitstreiter kennen.
Alex H. war ein guter Freund und hatte Interesse daran, das eine oder andere Stück zu singen, und Ana F. war eine sehr coole Gitarristin und überhaupt ein sehr cooler Mensch.
Ana hatte in Heidelberg bereits eine andere Band, die hauptsächlich Covers und “Partymucke” spielte, und sie bot mir an, ihren Proberaum mit zu nutzen und somit dem Zorn meiner Mitbewohner zu entgehen. Und weil’s so schön war bot sie sich auch gleich noch als Gast-Gitarristin an, falls sie gerade mal Zeit und Lust hatte.
Besagter Proberaum befand sich in einem heruntergekommenen Ex-Industriegebiet von Heidelberg in einer alten Lagerhalle.
Direkt nebenan befand sich wiederum eine andere, größere Lagerhalle, und ebendiese war von den (gleichen) Eigentümern zu einer sehr angesagten und erfolgreichen Event-Location umgebaut worden, in der immer wieder Konzerte und Parties und Performances stattfanden, und die dafür sorgte, dass sich die Eigentümer eine goldene Nase verdienten. Die restlichen kleinen Lagerhallen wurden an Bands und Künstler vermietet, und Ani und ihre Band hatten zugeschlagen und in einer der Hallen eine Art hölzernen Käfig gebaut, in welchem sich der Proberaum befand. Es gab keine Heizung, keine sanitären Anlagen, kaum Licht und Luft aber immerhin war es besser als gar nichts.
Eine zeitlang ging das recht gut, und im neuen Proberaum entstanden etliche neue Demos und schließlich auch fast fertige Aufnahmen. “Her Name”, “Onward” und eine spätere Fassung von “Little Princess” hatten allesamt ihren Ursprung in der heiligen Halle ohne Heizung und Klo.

Leider war da ein kleines Problem: Im Vergleich zu den Einnahmen, welche die schon erwähnte Event-Location generierte, waren die Mieteinnahmen aus den Proberaum-/Atelierhallen total lächerlich. Und da es sich bei den Vermietern keinesfalls um die großen Kunstförderer handelte, als die sie sich in der lokalen Jubelpresse gerne hochstilisieren ließen, sondern eben doch nur um ganz normale und traurige Auswüchse eines ganz normalen und traurigen Kapitalismus, konnten sie den Hals bald nicht mehr voll genug kriegen.
Eines Tages hatte ich also Ani am Telefon, die mir sagte: „Stephan, es gibt Schwierigkeiten. ****** möchte die Miete erhöhen. Er will jetzt 400 Euro pro Monat“.
Bis dahin hatten wir 150 Euro gezahlt (was für eine kleine, schäbige Lagerhalle ohne sanitäre Anlagen und Heizung auch schon viel zu viel ist). Mehr als das Doppelte war nicht im geringsten akzeptabel, und es war damals für uns auch nicht machbar.
„Und, habt ihr ihm gesagt, dass das eine totale Frechheit ist und nicht geht?“ fragte ich.
„Ja, das haben wir ihm gesagt. Er hat gesagt, dann sollen wir halt verschwinden. Aber ich glaub nicht dass er es ernst meint, so scheiße kann ein Mensch doch gar nicht sein… wir reden da nächste Woche noch mal in Ruhe noch mal darüber…“
Wie sich aber herausstellte war er sogar noch wesentlich mehr scheiße. Denn als wir uns am nächsten Tag, oder besser gesagt um halb elf in der Nacht, an der Tür zur Halle einfanden, um ein neues Demo aufzunehmen, kamen wir nicht mehr rein. Jemand hatte schon mal vorsorglich und zum Erlangen einer besseren Verhandlungsposition die Schließzylinder ausgetauscht.
Rock Bottom

Tja, und dann standen wir da.
Mutterseelenallein, im kalten Regen, mitten in der Nacht, vor der verschlossenen Tür mit dem ausgewechselten Schließzylinder.
Niemand sagte mehr was.
Heidelbergs ach so große Kunstförderer hatten uns soeben nach Strich und Faden gefickt, und zwar einfach nur deshalb, weil man es mit uns ja machen konnte. Und dementsprechend fühlten wir uns. Heutzutage würde ich meinen Rechtsanwalt bitten, diesen Menschen bitte mal eben den kategorischen Imperativ zu erklären (bzw. erst gar nichts mit ihnen zu tun haben) und währenddessen noch alle viralen Social-Media-Hebel in Bewegung setzen, damit nie wieder eine Sterbensseele ihre beschissenen Veranstaltungen in ihrer beschissenen Halle besucht. Aber damals war das einfach nicht drin, ich hatte kein Geld und war ein Niemand.
Ich fuhr also heim und wollte erst mal nichts und niemanden mehr sehen… ganz davon abgesehen, dass es eh niemanden interessiert hätte. Diese Stimmung hielt auch die nächsten Wochen hindurch an. Irgendwann hatte Ani den Vermieter mit ganz vielem Gut-Zureden dazu gebracht, doch noch mal die Tür für uns zu öffnen, und so konnten wir zumindest unsere Instrumente in Sicherheit bringen. Ich verfasste noch einen emotionalen und genervten Hilferuf hier im Blog, aber der verhallte selbstverständlich ungelesen und umkommentiert.
Und irgendwann saß ich in meinem kleinen WG-Zimmer und es wurde mir die ganze traurige Realität meines aktuellen Daseins mit einem Mal klar. Wie viel einfacher und schöner in Karlsruhe wirklich alles gewesen war: Das Musizieren in der zum Studio umgebauten Werkstatt in unserem Hinterhof, umgeben von Freunden, die sich an der Musik erfreuten; mit gemeinsamen Unternehmungen, langen Ausflügen in die Rheinauen und an die wunderschönen Baggerseen, und mit grenzenlosem Verliebtsein, von dem ich mir sicher war, es würde ewig so bleiben, ebenso wie ich all die anderen Dinge für immer während und selbstverständlich ansah… und im krassen Gegensatz dazu hier, dieses ewig feindliche und kalte Scheiß-Heidelberg, wo niemand mich verstand, wo ich die ganze Zeit nur Steine in den Weg gelegt bekam, und wo ich mir jetzt nicht mal mehr die Ausübung meiner Berufung in einer dummen, kleinen, heruntergekommenen Lagerhalle leisten konnte. Und es überkam mich eine grenzenlose, entsetzliche Sehnsucht nach dieser besseren Zeit.
I Cry
Und so tat ich das, was ich mir nicht mehr zu tun geschworen hatte: Ich setzte mich hin und schrieb einen Song über mich selbst.
Mir war zum Heulen zumute aber ich konnte nicht. Und ich dachte mir, wenn ich es irgendwie niederschreiben könnte, wie schön es war, und wie viel mir fehlt, dann könnte ich es vielleicht… einfach hemmungslos all meine Enttäuschung und Trauer darüber rauslassen. Und so überschrieb ich das leere Blatt Papier vor mir mit „I Cry“.

Doch so schlimm sollte es nicht werden. Es würde (was mir da noch nicht klar war) kein grenzenlos wütender und depressiver Song über meine Situation werden, sondern eine Meditation über Schönheit, Geborgenheit und die Kostbarkeit des Moments… und die Krähen würden eine ganz besondere, große Rolle darin spielen.
Es war die Erinnerung an einen perfekten Moment – einen Moment, in dem einfach alles stimmte. Einen Moment voller Liebe, Freude, Freundschaft und Erfüllt-Sein. Die genauen Umstände beschreibt der Song ziemlich direkt, deshalb brauche ich sie hier nicht noch mal mit anderen Worten neu beschreiben und damit doch nur zu verwässern und ihnen die Magie zu nehmen:
The sun was setting, the wind was warm
There was magic everywhere
I held your hand as we gazed into the sky
And the crow cries filled the air
I laughed like the child in the dream
That I’d been dreaming for so long
Und tatsächlich waren überall Krähen gewesen, riesige Schwärme von Krähen… Vögel, zu denen ich nicht erst seitdem eine ganz besondere Beziehung habe… und mit denen ich nichts Düsteres verbinde, ganz im Gegenteil.

Vögel, die mir (ja, Stephan wird jetzt mal eben esoterisch, sei’s drum. Ich bin so derart 99% der Zeit wissenschaftlich korrekt, dass ich mir das jetzt durchaus erlauben darf) etwas Magisches bedeuten, eine sichtbare und spürbare Verbindung zu jener Welt, in der all dieser Blödsinn mit Schließzylindern, Geldverdienen, Weiterkommen und Karrieremachen keinerlei Platz und keinerlei Bedeutung hat; in der es die ganzen Leute die unser Dasein hier kälter und unmenschlicher machen nicht gibt, weil ihnen schlicht und einfach die Phantasie fehlt um dort existieren zu können. Und eine Welt, in der Leute wie ich nicht nachts durchgefroren und durchnässt vor verschlossenen Lagerhallen in heruntergekommenen Industriegebieten sitzen müssen, sondern wo wir unsere Musik spielen dürfen, und wo sie mit Freude angenommen wird.
Ich setzte mich an das gute alte Alesis-Drumpad und begann damit, einen Rhythmus einzuprogrammieren. Ich wollte etwas, was Weite und Offenheit vermittelt, im Gegensatz zu der kleingeistigen Schließzylinderwelt, in die ich mich irgendwie reinmanövriert hatte. Also traute ich mich an etwas polyrhythmisches, mit viel Delay… und gerade als ich ungefähr eine Ahnung bekommen hatte, wohin die Reise gehen würde (es war ca. halb 10 abends), da flog die Tür auf und meine Mitbewohnerin sagte mit vorwurfsvoller Stimme: „Stephan, ich hab morgen Klausur! Kannst Du das bitte wann anders machen.“
Um die Dinge hier mal ein bisschen ins rechte Licht zu rücken: Das Spielen auf einem Drumpad ist nicht besonders laut. Die erzeugten Drum- und Percussion-Sounds waren ausschließlich auf meinem Kopfhörer zu hören. Man kann ein normales Gespräch in Zimmerlautstärke führen, während auf einem Drumpad gespielt wird. Und meine Mitbewohnerin schrieb, wenn man die Häufigkeit und Vehemenz ihrer Beschwerden zugrunde legt, anscheinend jeden Tag eine Klausur. Das Ganze war also m.E. ziemlich übertrieben und albern, aber trotzdem stellte ich meine Drumpad-Aktivitäten ein, weil ich keinen Ärger wollte.
Stattdessen kramte ich mein Mini-Keyboard raus und improvisierte ein paar ziemlich billig klingende Synthi-Streicher über die ersten paar Takte die ich hatte. Und mit der Melodie kam auch der Text, erst die erste Strophe, wie oben zitiert, und schließlich die Einsicht, dass die Zeit unerbittlich weiter geht und die Welt nur darauf wartet, dass ich meine Tasten zu laut drücke…
Time keeps moving on
Time keeps moving on
Ich schrieb eine zweite Strophe, in der die Krähen wieder auftauchten, diesmal als Sehnsuchtsmotiv, als etwas, was verstummt war, und was ich mehr als alles in der Welt unbedingt wieder hören wollte… und da wurde mir auch klar, dass der Song nicht „I Cry“ heissen würde, sondern „The Crow Song“, denn das war es, worum es ging: Jene Vögel, die für mich diese andere Welt bedeuteten, zu der ich keinen Zugang mehr fand…
I want to wait for the crows
And then just sit there
And listen to their cries
…und damit legte ich meinen Schreibblock beiseite, beendete meine Recording-Software und damit auch die Arbeit an diesem neuen Lied.
Ich hatte keine Ahnung, ob, wann und wo ich jemals die Gelegenheit bekommen würde, es fertig zu schreiben und aufzunehmen.

Pipifax To The Rescue!
Ein halbes Jahr lang geschah äusserst wenig bis gar nichts. Die Aussicht, ausschließlich in meiner kleinen WG-Legebatterie unter den Argusaugen meiner Mitbewohnerin Musik machen zu können, erwies sich nicht gerade förderlich für meine Kreativität, und so reduzierte sich mein kreativer Output wieder mal auf Null.
Erstaunlicherweise war es aber ausgerechnet erwähnte Mitbewohnerin, die die Rettung brachte.
Denn eines Tages im Mai des Jahres 2005, als wir zum Frühstücken zusammen saßen, erzählte sie mir von einem früheren Bekannten von ihr, der jetzt auch in die Gegend gezogen war. Genauer gesagt, 20km entfernt ins beschauliche Dilsberg, wo er ein Café eröffnet hatte. Und: „Den musst Du eigentlich kennenlernen, der ist genau so komisch drauf wie du, und der macht auch Musik“.
Gesagt getan, wir unternahmen einen Ausflug zum Dilsberg hoch und dort lernte ich Gerd Becker und sein Café Pipifax kennen.
(Ergänzung 2018: Das Pipifax hat inzwischen seine Pforten geschlossen… leider erging es Gerd schließlich wie so vielen anderen Künstlern und wahren Kunstförderern auch: irgendwie finden es die Leute toll, aber bezahlen möchte es niemand)

Der Dilsberg, das umfasst eigentlich auch „die Feste Dilsberg“… und dabei handelt es sich um eine alte Festung, in der sich ein kleines, wunderhübsches Dorf befindet, das direkt aus einem alten tschechischen Märchenfilm entsprungen sein könnte. Es ist eine ganz unglaublich charmante Kulisse. Ebenso wie das Café Pipifax selbst, welches unweit des Burgtores (richtig, es gibt ein Burgtor) liegt. Und, was noch besser war, wir stolperten dort mitten in eine im Gange befindliche Jamsession. Ich fühlte mich sofort zuhause. Wir setzten uns dazu, liessen die Musik auf uns wirken, nahmen das ein oder andere Getränk zu uns und kamen schließlich mit Gerd ins Gespräch. Wie sich herausstellte hatten wir eine ganz ähnliche Vergangenheit und wollten beide versuchen, jetzt wieder ein bisschen Musik zu machen.

Beim nächsten Besuch schleppte ich schon Keyboard & Verstärker mit und nahm mit großer Freude an der Jamsession teil. Es wurde wild drauflos improvisiert, und nach all den Monaten der Abstinenz war das ein ganz fantastisches Gefühl. Wir wurden schon sehr bald zu Dauergästen im Café Pipifax, und es dauerte auch nicht lange, bis Gerd mehr von mir, von Botany Bay und von meinen gescheiterten Aufnahmen und der ganzen verfickten Halle03-Scheiße erfuhr.

Sein Lösungsvorschlag war verblüffend einfach: „Ach, wir haben da unten neben der Landstraße einen Proberaum in einer alten Scheune, Du kannst Dein Equipment gerne dort aufstellen. Wir sind da nur einmal die Woche drin, wenn’s hoch kommt. Den Rest der Zeit kannst Du rein…“
Dankbar nahm ich das Angebot an, und Tags darauf fand ich mich an der alten Scheune unweit der Landstraße ein, den Gerds Band ‚The Wheel Ranch‘ getauft hatte… und hatte endgültig das Gefühl, heimgekommen zu sein. Einen größeren Unterschied zu dem dunklen und dreckigen Loch in Heidelberg, aus dem wir ausgesperrt worden waren weil wir dafür keine 400 Euro zahlen wollten, kann man sich nicht vorstellen. Die „Wheel Ranch“ befand sich quasi mitten auf der grünen Wiese, nebenan war ein Wald, davor in einiger Entfernung die Landstraße, und dahinter in noch mehr Entfernung eine große Pferdeweide.
Mit allem, was ich vorher in Heidelberg erlebt hatte, kam ich mir vor, als wäre ich direkt in ein Märchen gelaufen. Aber es war wahr.
Explosion
Am ersten Tag in der Wheel Ranch konnte ich meine Freiheit noch gar nicht richtig fassen. Ich hatte mich schon viel zu sehr daran gewöhnt, dass meine Musik als seltsam und störend empfunden wurde.
Doch nach und nach kapierte ich es, und „The Crow Song“ war das erste Stück, dem ich mich umfassend widmete, und mit dem ich meine wieder gewonnene Freiheit schließlich richtiggehend zelebrierte.
Es wurde mir später erst klar, aber an diesem Tag veranstaltete ich einen wahrhaftigen Exorzismus. Jegliches „kannst Du das bitte leiser machen“ und „kümmer Dich doch mal um Deine Zukunft“ und „das Arschloch hat die Schließzylinder ausgetauscht“ wurden in ohrenbetäubender Lautstärke aus meiner Wirklichkeit verbannt.
Zunächst mal wurden die Drum-Patterns neu eingespielt, und zwar diesmal nicht mit Kopfhörern sondern schön mit sattem Sound über die Monitorlautsprecher. Und auch nicht nur vier Takte lang, sondern minimum 15 Minuten am Stück. Ich bin ein großer Verfechter der Theorie, dass ein Track viel lebendiger klingt, wenn möglichst viel am Stück und live eingespielt wird und nicht irgendwie komisch verhackstückelt und geloopt und was weiß ich was.
Dann gab es in meinem Besitz eine schier unüberschaubare Menge „echter“ Percussion-Instrumente, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt hatte. Die wurden alle rausgeholt und ebenfalls verwendet. Insbesondere die große Djembe ist auf dem fertigen Song sehr deutlich herauszuhören, aber auch diverse Shaker, ein Chicken Egg und sogar ein altes Plastikrohr aus Ubik-Paint-Zeiten finden sich im Mix. Es gibt wenige Songs auf „Grounded“, auf denen so viel Percussion zu hören ist wie auf dem „Crow Song“… einfach nur weil ich es endlich wieder konnte.

Als nächstes waren die Streicher dran. Auf meinem zaghaften WG-Zimmer-Demo kamen die von irgend einem Softwareinstrument meiner damaligen Recording-Software und sie klangen ziemlich dünn und zaghaft. Das war nicht im geringsten passend, diese Flächen mussten groß und gewaltig kommen!! Also wurden die dünnen Software-Instrument-Spuren weggeschmissen, und stattdessen wurde etwas aufgebaut, was für groß und gewaltig sorgen würde: Nämlich mein alter Emu Proteus II, verstärkt durch meinen noch sehr viel älteren Echolette Röhrenverstärker und in die Welt gebrüllt vermittels einer wurmstichigen 4xLautsprecherbox, die ich zu diesem Zweck in einen eigenen Raum stellte und in einiger Entfernung davon durch zwei dynamische Mikros stereo abnahm.
Ich mache inzwischen echt sehr viel mit dem Computer – aber ich glaube, keine Computer-Simulation kann den ganz eigenen, breiten, etwas kaputten aber dafür durch und durch majestätischen Sound nachbilden, den ich damals mit diesem Setup schließlich erzeugte, und der dem Crow Song (auch) seinen ganz eigenen Charakter verleiht. Ausserdem glaube ich, der gigantische Lärm, den ich dabei veranstaltete, war noch zwei Kilometer entfernt auf der Feste Dilsberg zu hören.
Und vermutlich ist es jetzt auch allerspätestens an der Zeit, das fertige Stück mal wieder zu hören, denn mit all den nun bereit gestellten Informationen sollte es für den geneigten Leser/Hörer ein wenig einfacher sein, eine ungefähre Ahnung davon zu bekommen, wie sich das damals alles angefühlt hat…:
Mitstreiter und Sonstige Menschen
Ani, meine damalige Gitarristin, hatte in jener Woche keine Zeit, und ich wollte unbedingt Gitarre auf dem Teil haben und nicht länger auf irgendwas oder irgendwen warten, denn ich hatte schon viel zu viel Zeit mit Warten verbracht. Also griff ich kurzerhand selbst zum türkis gefärbten billig-Stratocaster-Nachbau aus dem schönen Japan. Auch hier kam mir der neue Raum sehr entgegen, denn ich bin wahrlich kein Virtuose auf der Gitarre, und bis ich ein heulendes und sehnsuchtsvolles Feedback zufriedenstellend hingekriegt hatte, wurden so einige sehr fürchterliche Misstöne erzeugt. Stellenweise wollte es auch überhaupt nicht meiner Vorstellung gemäß klappen, und so wurden zusätzlich noch Samples und das gute alte G4-Powerbook zur Hilfe genommen. Das Ergebnis auf dem Crow Song klingt sehr schön und harmonisch, aber das sind auch wenige Sekunden Auswahl aus sehr, sehr vielen Fehlversuchen.
Wer hingegen Zeit hatte, war Alex H., mein damaliger Sänger für alle Lebenslagen. Und so fuhren wir am nächsten Tag wieder zusammen hoch zur „Wheel Ranch“, und Alex konnte seine wunderbaren Vocals auf einem so gut wie fertigen Song abliefern. Er staunte nicht schlecht, wie weit ich in ganz kurzer Zeit gekommen war… und wie sehr sich der Sound verändert hatte. Und ebenso staunte er über die Location, von der er bei dieser Gelegenheit ein Foto nach dem anderen machte. Sollten die noch irgendwann auftauchen, so hätte ich auch endlich Bilder von der Wheel Ranch… denn bei allem, was ich dort nachholen musste, kam ich leider nie auf die Idee, Fotos zu machen. Genau aus diesem Grund muss dieser Artikel auch mit Bildern aus der Umgebung auskommen… zumindest, bis Alex auf meine Nachrichten reagiert und eventuell die Fotos noch hat 😉
Alex gab alles auf dem Song… ich musste ihm gar nicht lange beschreiben, worum es mir ging und was ich wollte… er tat es einfach, extrem unkompliziert (wir brauchten glaub ich nur zwei, maximal drei Takes für den Gesang) und mit großer Empathie und dafür bin ich heute noch extrem dankbar und glücklich. Der Lauf des Schicksals war dafür verantwortlich, dass Alex nicht der hauptsächliche Sänger von Botany Bay wurde, sondern dass schon sehr bald eine gewisse Laura Dietrich diese Rolle und noch viel mehr übernehmen sollte… aber er hätte das Zeug dazu gehabt, und er war eine enorme Bereicherung für „Grounded“.
Coming Out
Der „Crow Song“ war schließlich auch das Lied, bei dem es mir erstmals gelang, es einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen als den damals zweieinhalb Lesern dieses Blogs.

Und zwar hatte mir irgendjemand von einer Plattform namens „garageband.com“ erzählt. Die Idee dahinter war, dass unbekannte Acts ihre Musik vorstellen und von anderen Menschen rezensieren lassen konnten. Um selbst Musik hochladen zu dürfen, musste man zunächst ein gewisses Quantum an Rezensionen schreiben (oder Geld zahlen), und die ganze Technik war dabei so intelligent gelöst, dass man nicht einfach auf „skip“ gehen konnte, sondern man musste wenigstens die Hälfte oder so des Songs anhören. Und für nur drei Worte Review kam man auch nicht wesentlich weiter, denn auch die Reviews wurden von zufälligen Teilnehmern anonym bewertet, so dass eine gewisse Qualität sichergestellt war.
Ein ziemlich geniales Konzept, denn es förderte das Entdecken neuer Musik und den Austausch zwischen Musikern.
Leider wurde „garageband.com“ irgendwann von myspace gekauft und wenige Monate später gegen die Wand gefahren, denn wo kämen wir denn da hin wenn das Internet dazu da wäre, wirklich alternative und neue Musik zu entdecken und dabei keine Werbeeinnahmen für die Major Labels zu generieren? Genau, das wäre eine Revolution, und deshalb gibt’s das Ganze auch nicht mehr.
Damals aber war das noch anders, und für mich war es ein kleines Wunder. Denn hatte mich mein direkter Umkreis bis dahin hauptsächlich mit „mach das bitte leiser“ und „lass mich in Ruhe mit Deiner Musik“ und „mach endlich was vernünftiges“ bedacht, so bekam ich plötzlich vollkommen gegenteiliges Feedback von anderen Musikern, und von Musikinteressierten.
Und nicht nur das: Ich sammelte für „The Crow Song“ (und die nachfolgenden Veröffentlichungen) eine Auszeichnung nach der anderen ein. Für bestes Songwriting, beste Produktion, beste Vocals, beste Instrumentation, und was weiß ich noch alles. Und allmählich dämmerte es mir: So falsch war meine Musik anscheinend gar nicht. Sondern viel eher mein Umfeld.
An dieser Stelle muss ich etwas gestehen: Ganz klar ist es so, dass ich meine Musik auch vollkommen ohne Publikum machen würde. Wäre das Publikum und der Jubel mein einziger oder der Hauptantrieb, so hätte ich schon längst damit aufgehört – stellenweise gab es (und gibt es inzwischen wieder, story of my life) einfach überhaupt kein Feedback. Ich mache trotzdem weiter, ich muss einfach.
Aber: Es tut verdammt gut, ab und zu mal wenigstens ein bisschen Bestätigung zu bekommen. Und unter diesem Gesichtspunkt war garageband.com motivierend ohne Ende, denn ich bekam alles an Feedback, was ich die Jahre zuvor nie bekommen hatte. Endlich hörten Menschen meine Produktionen und fanden Gefallen daran – das war damals schon ein ganz aussergewöhnliches Gefühl, und ich ging nun ran wie der Teufel, denn garageband.com gab mir eine deutliche Ahnung davon, wie erfolgreich das alles sein könnte, wenn ich nur ein bisschen Glück und die richtigen Kontakte hätte.
Nicht dass das jemals passierte, aber das Gefühl war ein enorm gutes.
Und auch wenn wir inzwischen eine Fanbase haben, mit der ich zufrieden sein kann – tatsächlich hat uns unser ältester Fan (Hallo Björn!) auf garageband.com kennen gelernt –, so muss ich leider zugeben, dass wir nach der Schließung von garageband.com ein solches Level an Feedback niemals wieder erreichten. Einmal mehr haben sich die vermeintlichen “Kunstförderer” durchgesetzt und den Alternativen ihre Existenz noch ein Stück schwerer gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte für ein anderes Posting.
Enter Laura

Wenige Monate später kam Laura zu Botany Bay, und aus einem zeitweise sehr einsamen „Stephan gegen den Rest der Welt“ wurde auf wundersame Weise schon sehr bald ein eingeschworenes und nicht mehr im geringsten einsames Duo, das in den folgenden Jahren fester und fester zusammen wachsen sollte. Aber auch das ist eine andere, noch viel längere Geschichte für ein anderes, noch viel längeres Posting, das ich nicht schreiben werde.
Auf jeden Fall waren Botany Bay ein Jahr später Laura und ich, da gab es nix dran zu rütteln. Und auch das Album, das die Welt ein weiteres Jahr später als „Grounded“ kennenlernen sollte, nahm immer mehr Formen an. Nur gab es da ein Problem: Ich war mir sehr sicher, dass „Grounded“ mit dem „Crow Song“ beginnen sollte… eben wegen der ganzen Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Weil „The Crow Song“ ein Aufbruch war, eine Art Wiedergeburt, die ganz am Anfang stehen sollte. Weil „The Crow Song“ mein Ausbrechen aus dieser grauen alles-egal-Welt darstellte, meine Rückkehr zu einer viel bunteren Welt und zu meinen Träumen.
Doch Laura, die sich zu diesem Zeitpunkt zur zweitwichtigsten Person und zur Stimme und zum Gesicht des Projektes gemausert hatte, war ausgerechnet auf dem Opener nicht zu hören. Also nahmen wir uns den Song noch mal vor und versuchten auf behutsame Art und Weise, Lauras Stimme so einzubauen, dass die Unternehmung nicht später als nachträgliche Ergänzung zu erkennen sein würde.
Zunächst ersann Laura ein paar wunderschöne Backing Vocals für die „laugh like the child in the dream“-Stellen, wobei sich ihre Erfahrung als Chorleiterin als sehr hilfreich herausstellte. Doch irgendwie reichte das noch nicht.
Also beschlossen wir, auch noch den „Refrain“, sprich, die „time keeps moving on“-Sequenz mit Backing Vocals zu versehen, und zwar diesmal nicht mit „aaaahs“ und „oooohs“ sondern etwas konkreter mit Worten. Aber schon nach dem ersten Versuch wurde uns klar, dass sich Alex’ und Lauras Stimme in dieser Sequenz derart beißen würden, dass es niemals funktionieren würde.
Da kam Laura die rettende Idee: „Schieb mich einen Taktstrich nach hinten“
Ich so: „Wie was?“
Sie so: „Einfach einen nach hinten, so dass ich ein Echo bin. Wie ein Echo aus einer anderen Zeit, darum geht es doch, oder?“
Ich tat wie mir geheißen, und tatsächlich: es funktionierte! Direkt auf jede von Alex’ trockenen, nüchternen und beinahe schon gesprochenen Feststellungen dass die Zeit sich unerbittlich weiter bewegt, folgte ein lyrisches, melodisches Echo von Laura… aus eben jener Zeit, die schon lange unwiederbringlich zur Vergangenheit geworden war.
Und genau so kam das Lied auch auf das Album.
Was noch fehlt
Es gäbe noch so viel zu erzählen zum „Crow Song“, weil es einfach ein so verdammt vielschichtiges und komplexes Lied ist. Aber dann würde der Artikel doppelt so lange werden, und es würde ihn endgültig niemand mehr lesen. Deshalb muss jetzt ich leider abkürzen und zum Ende kommen.
„The Crow Song“ war nicht nur der Opener von „Grounded“, er war auch der Opener in ein musikalisches Abenteuer, das bis heute anhält… er war der Opener auf der Premiere von „Grounded“ im Kulturfenster in Heidelberg, er war der Opener auf jedem einzelnen Botany Bay-Konzert und ein absoluter Publikumsliebling. Er bedeutet mir so viel wie nur wenige andere Songs, und das will etwas heißen, denn sie alle bedeuten mir viel. Und sollte ich jemals wieder in die Lage kommen, Konzerte spielen zu können (sprich: Mitmusiker zu finden, die interessiert sind und dabei bleiben), dann werde ich ihn wieder am Anfang spielen.

Bleibt eigentlich nur noch eines zu sagen:
Wenn ich könnte, dann würde ich meinem Ich von damals, das vor der verschlossenen Tür mit dem ausgewechselten Schließzylinder saß und fix und fertig mit der Welt war, an dieser Stelle eine Nachricht schicken:
Kopf hoch, Stephan, es wird alles werden. Ehrlich jetzt.
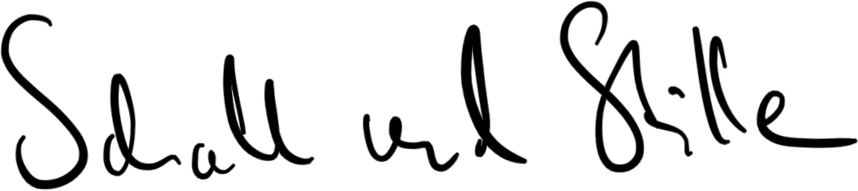

Leave a Reply